Das Olympische Bildungsmagazin
Lopez Lomong: The Lost Boy of Sudan
- Jens Weinreich
- 8. Juli 2008
- 12:35
- 8 Kommentare
https://www.youtube.com/watch?v=GlYNlrcfpwY&hl=en&fs=1
Ich habe gehofft, dass die Trials der US-Leichtathleten so enden würden. Ich habe für Lopez Lomong gehofft, einen der verlorenen Kinder des Sudan, der am letzten Tag der Trials in Eugene/Oregon im Finale über 1500 Meter stand. Wenn Lomong sich für die Olympischen Spiele in Peking qualifizieren sollte, würde auch seine Geschichte um die Welt gehen. Diese Geschichte, die Lomong zu Beginn der Trials erzählte, lässt einem den Atem stocken.
Ich hatte eigentlich vor, eine mp3-Datei ins Netz zu stellen, aber ich war zu blöd, das Gespräch mit Lomong in erträglicher Qualität aufzuzeichnen. So bereite ich jetzt meinen Text, den ich gestern einigen Zeitungen geschickt habe, fürs Netz auf. Seine Geschichte wird bis Peking und während der Spiele und auch danach noch hundert Mal in vielen Sprachen erzählt. Das ist gut so, sie kann gar nicht oft genug erzählt werden.
Die Olympianormzeit hatte Lomong bereits vor den Trials erfüllt. Er musste nur noch Dritter werden in Eugene. Und auch das hat er geschafft, trotz einer Knöchelverletzung, im letzten Rennen der Trials. Auf diesen 1.500 Metern kulminierte so vieles. Wer mag, kann sich das Sportliche nochmal beim Olympiasender NBC ansehen. Es war eine große mit vielen kleinen rührenden amerikanischen Stories.
Die ersten drei dieses Rennens, die nun für die USA in Peking laufen dürfen, sind Immigranten. Stolz saßen sie später beisammen, sprachen über Freiheit, Hoffnung, Familie und Träume – Land of hope and dreams –, und haben dabei natürlich auch einige patriotische Bekenntnisse abgelegt, die ich – würde ich sie von anderen hören – nur peinlich finden würde.

1500m Sieger-PK in Eugene mit Lomong, Lagat und Manzano
Die drei Neu-Amerikaner:
- Der Doppel-Weltmeister von 2007, damals schon unter US-Flagge, Bernard Kipchirchir Lagat (Foto Mitte mit seinem Sohn Miika), geboren 1974 in Kapsabet, Kenia – wohnhaft in Tucson, Arizona, US-Staatsbürger seit 2004.
- Leonel Manzano (Foto rechts), geboren 1984 in Dolores Hidalgo, Mexiko – wohnhaft in Austin, Texas, US-Staatsbürger seit 2004.
- Und Lopez Lomong (Foto links), geboren 1985 in Kimotong, Sudan – wohnhaft in Flagstaff, Arizona, US-Staatsbürger seit Juli 2007.
Die drei wurden nicht etwa staatlich rekrutiert, wie das in Deutschland bei Sportlern üblich ist und jüngst gerade am Beispiel des Basketballers Chris Kaman absurde Blüten trieb. Nein, diese drei Läufer haben lange auf ihre Chance gewartet, sie haben darum gekämpft, den Pass ihres neuen Heimatlandes zu erhalten. Dem listigen Bernard Lagat, der 2007 zweimal Weltmeister wurde als Neu-Amerikaner, sagt man zwar nach, er renne nur für die USA, weil er fürchtete, sich in Kenia nicht noch einmal für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Selbst wenn, ist das verboten? Lagat lebt seit einem Jahrzehnt in den USA, er hatte seit 1999 die Green Card.
Leonel Manzano kam als Vierjähriger mit seinen Eltern nach Austin. Seine mexikanische Mutter verdingt sich, natürlich, wie im Film, als Kindermädchen. Sein Vater schuftet an einer Steinbrecher-Maschine.
Meine Eltern wissen was Arbeit ist. Sie haben sich immer gewundert, über das, was ich mache. Aber inzwischen haben sie es verstanden.
Lagat und Manzano wuchsen in geordneten Verhältnissen auf. Von Lopez Lomong lässt sich das nicht sagen.
Lopez Lomong stammt aus Sudan, wo seit Anfang der achtziger Jahre der Bürgerkrieg tobt. Er gehört zum Stamm der Boya, er wuchs in Kimotong auf. Was er durchgemacht hat, reicht für zehn Leben. Lomong hat die Abgründe der menschlichen Rasse gesehen und erleiden müssen. Es ist ein Wunder, dass er nicht verhungerte, es ist ein Wunder, dass er nicht abgeschlachtet wurde, wie zehntausende andere Kinder seiner Generation. Er kann mit stockender Stimme beschreiben, wie es ist, wenn Kinder sterben, wenn sie ihr Leben aushauchen. Lomong kennt das kalte, metallene Geräusch, wenn die Kalaschnikows durchgeladen werden. Nun ist er 23 – und läuft als Amerikaner bei Olympia.
Lopez Lomong hat die ersten Jahre seines Lebens in den Wirren des Bürgerkrieges verbracht, immer auf der Hut vor den Dschandschawid, den berittenen, muslimischen Milizen.
Ich habe in der Wildnis laufen gelernt um mein Leben zu retten.
Er war sechs, als die Milizen sein Dorf überfielen und ihn mit einem Dutzend anderer Kinder, Mädchen und Jungs, verschleppten. Einige Mädchen wurden vergewaltigt, die Jungs zu Kindersoldaten ausgebildet. Lomong sollte töten. Doch nach etwa drei Wochen, sagt er, flüchtete er mit drei älteren Jungs durch ein Loch im Zaun des Lagers, in das man sie gesperrt hatte. Tagelang irrten sie durch die Savanne, durch wirkliche Wildnis. Teilweise trugen die großen Jungs, in Lomongs Erinnerung waren sie etwa 14 Jahre alt, den Kleinen auf dem Rücken. Bis sie von einer Grenzpatrouille festgenommen wurden. Es waren kenianische Polizisten, die Kinder waren bereits im Nachbarland gelandet.
Lomong landete im riesigen UN-Flüchtlingscamp in Kakuma, Nordkenia, wo teilweise 80.000 Menschen lebten, vor allem aus dem Sudan, Somalia, Äthiopien, Eritrea. Dort blieb er zehn Jahre.
Heute würde ich sagen, ich lebte im Elend. Aber ich kam aus der Hölle. Kakuma war für mich zunächst ein Paradies. Ich bekam täglich eine Mahlzeit. Es gab Wasser. Ich konnte spielen.
Als er von dem Programm der „verlorenen Jungs“ erfuhr, schrieb er seine Geschichte auf und bewarb sich. Er hatte Glück, durfte ausreisen: Über Nairobi, Kairo, Peking, New York und Syracuse landete er in Tully, New York State. Dort wurde er von Barbara und Robert Rogers aufgenommen – zusammen mit fünf anderen Jungen aus dem Sudan.
In Kakuma hat Lomong Suaheli und Englisch gelernt. Im Lager gewann er auch erste kleine Rennen. Dort verdiente er als Lumpensammler jene fünf Schilling, für die er einen Platz an einem Fernseher erkaufte, um die Übertragungen von den Olympischen Spielen in Sydney zu sehen. Lomong hat damals nicht wahrgenommen, dass der Kenianer Bernard Lagat eine Bronzemedaille gewann, auf der Strecke, auf der sie nun gemeinsam in Peking antreten. Lomong kann sich nur an einen Namen erinnern: Er war begeistert von Michael Johnson. „So schnell wie der wollte ich sein“, erzählt er.
Im vergangenen Jahr war Lomong erstmals wieder in Kenia, begleitet von einer Filmcrew des Senders HBO, und hat dort tatsächlich seine Mutter getroffen und vier der Geschwister, die überlebten. Die Rogers‘ hatten mit Hilfe der amerikanischen Botschaft erfolgreich gesucht. Lomong überweist ihnen monatlich eine Summe, die er entbehren kann, anfangs waren es 200 Dollar. Er tut was er kann.
Lomong gehört zu den Protagonisten des Team Darfur, das Sportler aus vielen Nationen vereint, die die Darfur-Politik der chinesischen Regierung kritisieren. Lomong weiß, dass ihm dieses Engagement während der Spiele in Peking Probleme bereiten könnte – nach den Regeln des IOC könnte er disqualifiziert werden. Aber im Moment denkt er nicht daran. Er will ja nicht wirklich Politik machen. Er will nur laufen. Für sich. Für Amerika. Für die verlorenen Kinder des Sudan. Und später will er ein Hotel betreiben – in Afrika, nicht in den USA.
Und noch einige Links:
- NBC: Road to joy
- ESPN: „I came all the way here, so I have to run“
- New York Times: Odyssey May End at Olympics for Lomong


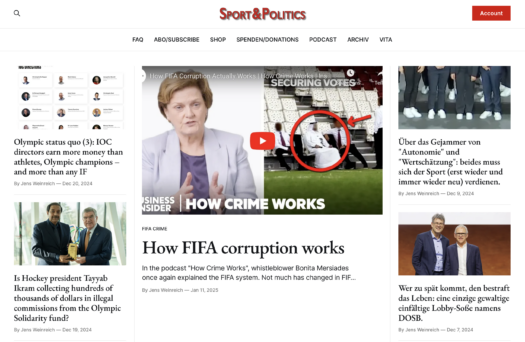





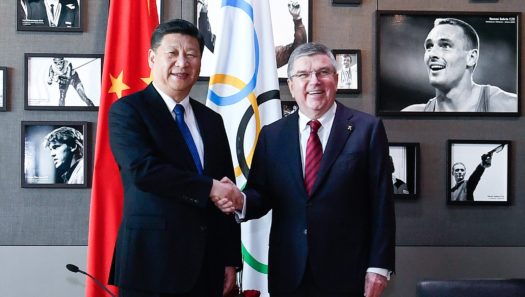



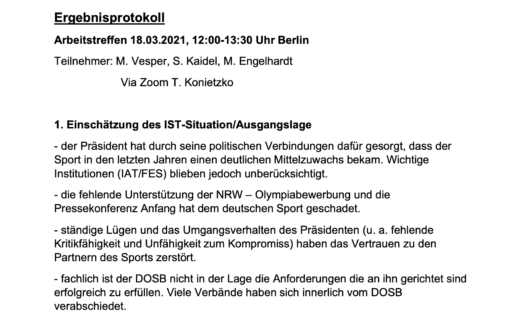


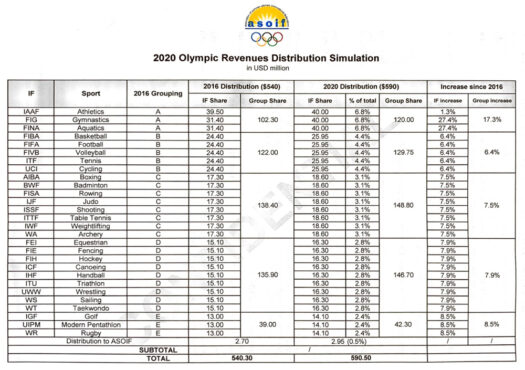


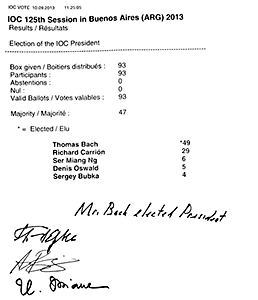

Wahnsinn, bei der New York Times Story lief mir am Ende ein kalter Schauer über den Rücken… was ein Gutes Zeichen ist! Diese Story und der Mann haben es wirklich in sich… bleibt wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Hollywood sich auf die Thematik stürzt
Mich hat die ESPN-Geschichte noch ein bisschen mehr gefesselt. Ich hätte es an deren Stelle in den USA auch so groß verkauft.
Pingback: Peking, Tag 6 : jens weinreich
Pingback: Lopez Lomong (III) oder: der Fahnenträger : jens weinreich
Pingback: aasport
Pingback: POLITISCH KORREKT » Der verlorene Junge
Pingback: Was vom Tage übrig bleibt (14) : jens weinreich
Pingback: Bob Munro und die Gefahren für Whistleblower : jens weinreich