Das Olympische Bildungsmagazin
Beijing 2000
- Jens Weinreich
- 28. März 2008
- 19:54
- 14 Kommentare
 Nein, nein, das ist kein Flüchtigkeitsfehler. Hier steht tatsächlich: Beijing 2000. Ich möchte nur mal daran erinnern, dass die Olympischen Spiele eigentlich schon im Jahr 2000 in Peking stattfinden sollten. Wenn nicht, ja wenn nicht die Australier in der Nacht der Nächte, also jener zum 23. September 1993, rasch noch zwei Afrikaner bestochen hätten. Samaranchs Leute wollten die Spiele in Peking schon Anfang der neunziger Jahre – nur kurz nach dem Massaker auf dem Tiananmen. Hier also die Geschichte, warum die Spiele dennoch nach Sydney kamen. Es ist eine Geschichte aus einer Zeit, als IOC-Mitglieder in China noch als „Ratten“ und „Diebe“ bezeichnet wurden. Vorsicht, es ist ein sehr langer Text, aber es ist ja Wochenende:
Nein, nein, das ist kein Flüchtigkeitsfehler. Hier steht tatsächlich: Beijing 2000. Ich möchte nur mal daran erinnern, dass die Olympischen Spiele eigentlich schon im Jahr 2000 in Peking stattfinden sollten. Wenn nicht, ja wenn nicht die Australier in der Nacht der Nächte, also jener zum 23. September 1993, rasch noch zwei Afrikaner bestochen hätten. Samaranchs Leute wollten die Spiele in Peking schon Anfang der neunziger Jahre – nur kurz nach dem Massaker auf dem Tiananmen. Hier also die Geschichte, warum die Spiele dennoch nach Sydney kamen. Es ist eine Geschichte aus einer Zeit, als IOC-Mitglieder in China noch als „Ratten“ und „Diebe“ bezeichnet wurden. Vorsicht, es ist ein sehr langer Text, aber es ist ja Wochenende:
Die Nacht der Nächte
bearbeitetes Kapitel aus Der olympische Sumpf
Eins muß man ihm lassen, dem Roderick McGeoch. Er ist ein ziemlich cooler Typ. Diesen Eindruck vermittelt er jedenfalls in seinem Büchlein The bid, seinen Memoiren über die Olympiabewerbung Sydneys, die er mit angeführt hat. Die Welt schaute Ende September 1993 gebannt nach Monte Carlo, wo sich der Gigant China, das bevölkerungsreichste Land der Erde, mit dem demographischen Winzling Australien duellierte.
Peking gegen Sydney, das war ein Politikum. Hatten nicht eben noch der US-Senat und Großbritanniens Außenminister Douglas Hurd gemahnt, das IOC dürfe die Olympischen Sommerspiele 2000 wegen der Menschenrechtssituation nicht nach China vergeben? Hatte es nicht schon diplomatische Verwicklungen auf höchster Ebene gegeben? Hatten die Chinesen nicht versprochen, im Falle ihres Sieges die Antlitze der IOC-Mitglieder in die Große Mauer zu meißeln? Und im Falle einer Niederlage die Spiele 1996 in Atlanta zu boykottieren? Botschafter und Minister waren wochen-, ja monatelang auf Tour gewesen in den Ländern der dritten Welt. Wenn wir in ein afrikanisches Land kamen, hatte einer von McGeochs Mitarbeitern mal gesagt, war die Straße vom Flughafen in die City frisch geteert, und ein neues Stadion war auch gebaucht – daran konnten wir sehen, daß der chinesische Sportminister vor uns da war.
In Monte Carlo, dem Paradies der Reichen und Schönen, fanden sich am Abend vor der Abstimmung die Olympiawerber und Lobbyisten noch einmal in der Oper ein, um die IOC-Mitglieder zu umschmeicheln. Fast alle trafen sich dort. Rod McGeoch aber blieb ganz gelassen. Seinen Text für die Abschlußpräsentation hatte er längst auswendig gelernt. Sein Feld war bestellt. Der Anwalt aus Sydney, der am nächsten Tag als Sieger von Monte Carlo australische Geschichte schreiben wollte, dieser Mann vergnügte sich in einem Restaurant mit ein paar engen Freunden, anstatt am Hofe Samaranchs zu buhlen. Fernab des olympischen Trubels speiste er seelenruhig mit seiner Frau Deeta, dem indischen IOC-Mitglied Ashwini Kumar und dessen Gemahlin Renuka.
„Es musste etwas geschehen“
Unter freiem Himmel scherzte das Quartett und erinnerte sich an viele gemeinsame Erlebnisse – war es nicht toll, wie der Dienst an der olympischen Bewegung Völker und Kulturen verbindet? McGeoch klinkte sich hin und wieder aus der Unterhaltung aus. Stolz dachte er darüber nach, wie professionell er diesen gigantischen Marketingcoup vorbereitet hatte. Sydney schlägt Peking, davon war er überzeugt. Nichts hatte er außer Acht gelassen. Am Morgen war die International Herald Tribune mit einer farbigen Beilage erschienen, deren Titelseite ein riesiges Foto von Downtown Sydney schmückte: Sydney, Australia, The place to be. Die Anzeige hatte die Fluggesellschaft Quantas spendiert, eine der Hauptsponsoren des Bewerberkomitees. Für den Abend war eine weitere Aktion organisiert: Jedes IOC-Mitglied würde in seiner Suite im Hotel de Paris den buntbemalten Brief eines Schulkindes auf dem Kopfkissen finden, geschmückt mit dem Schriftzug: Please give Sydney the Games.
Zwei Tage zuvor hatte sich McGeoch auch von der Meldung nicht schocken lassen, der Brasilianer João Havelange sei in Samaranchs Auftrag für die Chinesen auf Stimmenfang. Fußball-Präsident Havelange bedrängte wie eh und je seine südamerikanischen und afrikanischen Kollegen. McGeoch besprach den ärgerlichen Vorgang umgehend mit seinem Landsmann Kevan Gosper, dem IOC-Vizepräsidenten: „Du musst Havelange unbedingt stoppen.“ Soviel hatte Gosper ja zuvor nicht für Sydneys Bewerbung getan, eher viel zu wenig, wie John Coates monierte, der Präsident des Australian Olympic Committee (AOC). Doch diesmal ging Gosper knallhart ans Werk. Er stellte den imposanten Havelange, den Mann mit dem Cäsaren-Schädel, auf dem Flur des Konferenzzentrums Sporting d´Eté zur Rede. Er soll, in Gegenwart anderer IOC-Mitglieder, ziemlich laut geworden sein. Havelange ging verärgert und erstaunt seiner Wege. McGeoch nahm an, die Sache sei damit erledigt. Was wußte er schon von Havelange.
Während also der siegessichere McGeoch bei Wein und Meeresfrüchten gemütlich mit dem Ehepaar Kumar geplaudert haben will, müssen sich in Sydneys Wahlkampfzentrale erschütternde Szenen abgespielt haben, worüber McGeoch in seinen Memoiren leider nichts zum besten gibt. Eine schlechte Nachricht elektrisierte plötzlich das Team, denn nach neusten Hochrechnungen und Gerüchten sollte Peking in der Gunst der IOC-Mitglieder noch deutlicher vor Sydney liegen, als Anfang der Woche noch die ehemalige IOC-Direktorin Monique Berlioux prophezeiht hatte: Mit den Worten „Peking erreicht schon in der ersten Runde die absolute Mehrheit“, wurde die Französin vom samaranch-hörigen Mitteilungsblättchen sport intern zitiert. Aus den 45 von Berlioux erwarteten Stimmen waren auf dem Graumarkt nun schon 48 geworden.
Die Australier wurden panisch. „Unser Vorsprung war zusammengeschmolzen, es mußte etwas geschehen“, bangte John Coates. „Ich wollte mich nicht den Rest meines Lebens fragen müssen, warum wir nicht gewonnen haben.“ Also entschied sich Coates für eine patriotischen Tat, um die Sache des Vaterlands zu retten. Er hatte viele gute Freunde in Afrika, und es existierten bereits Förderprogramme unter dem Stichwort „olympische Solidarität“. Da mußte doch etwas zu machen sein.
John Coates war ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet. Von 24. Juli bis 20. August 1993, einen Monat vor der Abstimmung in Monte Carlo, hatte er mit drei Mitarbeitern eine lange Bildungsreise durch elf afrikanische Länder unternommen, natürlich nur, um die sportlichen „Beziehungen auszubauen und zu stärken“, wie es in einem Memo an den späteren Olympiaminister Bruce Baird hieß. Die Tour der Freundschaft führte Coates nach Nigeria, an die Elfenbeinküste, nach Mali, Togo, Kamerun, Kenia, Uganda, Swaziland, Mauritius, Kongo und Simbabwe. Zehn dieser elf Länder hatten ein IOC-Mitglied, das elfte, Simbabwe, mit Tomas Sithole zumindest schon einen einflußreichen Funktionär, der drei Jahre später ins IOC gelangen sollte. In allen Ländern schloß Coates Kooperationsverträge ab. Das AOC verpflichtete sich, den jeweiligen NOK finanzielle Hilfe bei der Ausbildung von Athleten angedeihen zu lassen.
Sydneys Blitzofferte
Die Kontrakte beinhalteten stets zwei Varianten: Im Fall, daß Sydney die Spiele nicht bekommen hätte, wären jedem NOK nur 18.000 australische Dollar zugegangen, insgesamt 198.000 Dollar. Für einen Sieg von Sydney wurden weitere 1,737 Millionen Dollar versprochen (aufgeteilt nach Größe der Länder, zwischen 123.000 und 278.000 Dollar). Die 18.000 pro NOK waren also die garantierte Vorspeise – welches Interesse sollten die Afrikaner gehabt haben, nicht für Sydney zu stimmen und damit den ungleich schmackhafteren Hauptgang zu verschmähen?
Das aber war nicht genug. Ein Nachtisch mußte her. John Coates verabredete sich mit zwei Francis Nyangweso und Charles Mukora, den IOC-Mitgliedern aus Uganda und Kenia, auf die Schnelle zu einem außerplanmäßigen Nachtmahl. Während die Gäste noch über ihren Speisekarten brüteten, hatte Coates sein Anliegen schon vorgetragen, es blieb ja nicht mehr viel Zeit: Er offerierte beiden Funktionären, die auch die NOKs ihrer Länder führten, je 35.000 US-Dollar als Sonder-Solidaritätszahlung gewissermaßen, für den Fall, daß Sydney die Spiele bekommt. Und er gab ihnen das Versprechen sogar schriftlich – Stunden vor den großen IOC-Präsentation der fünf Olympiabewerber. Natürlich läßt sich erahnen, wie Nyangweso und Mukora der nächtliche Vorschlag gefallen hat. Bevor wir aber Sydneys Blitzofferte weiter verfolgen, wollen wir die beiden Afrikaner näher vorstellen. Vor allem Nyangweso kann auf eine schillernde Karriere zurückblicken.
Der Freund des Menschenschlächters
Francis Were Nyangweso, Jahrgang 1939, war Olympiaboxer 1960 in Rom. Er absolvierte eine britische Militärakademie und gelangte in seiner Heimat bald in verschiedene verantwortungsvolle Positionen. Er jobbte als Bankier, Protokollchef des Außenministeriums, Botschafter, Kulturminister und als Verteidigungsminister. Nyangweso befehligte die ugandischen Streitkräfte zwischen 1973 und 1975, diese Jahreszahlen wurden in der aktuellen Ausgabe der IOC-Biographien diskret getilgt. Zu dumm aber auch, denn Generalmajor Nyangweso war Verteidigungsminister unter dem Menschenschlächter Idi Amin.
Der selbst ernannte „Hitler Afrikas“ hatte 1971 nach einem Militärputsch die Macht übernommen. Bis zu seinem Sturz acht Jahre später ließ Idi Amin mehrere hunderttausend Einwohner ermorden. Amin und Nyangweso, zwei passable Boxer, sind seit den fünfziger Jahren eng befreundet. Als Amin dann ins Exil nach Saudi-Arabien geflüchtet war, begann Nyangweso eine Karriere als Sportfunktionär. Er übernahm das NOK und ließ sich seit 1981 stets wiederwählen, dabei bediente er sich zahlreicher Tricks: So installierte er alte Kampfgefährten an der Spitze von nationalen Föderationen (Rudern, Bogenschießen, die zwar nicht wirklich existieren und Verbandsarbeit betreiben, jedoch über den NOK-Vorsitz mitentscheiden dürfen. Ins IOC gelangte Nyangweso 1988. Seine Kontakte zum Massenmörder Amin sind nie abgerissen. Ein Reporter der Zeitung New Vision führte 1999 ein Interview mit Big Daddy, dem Exilanten, der 2003 starb. In dem Gespräch bezeichnete Idi Amin das IOC-Mitglied als einen seiner besten Freunde und seinen wichtigsten Kontaktmann in Uganda.
Der Brausebrauer
Mukora, Jahrgang 1934, wurde in England zum Sportlehrer ausgebildet. Nach der Unabhängigkeit Kenias wechselte er vom Schul- in den Staatsdienst. Er war Cheftrainer der kenianischen Leichtathleten und Sportverantwortlicher der Regierung. Bis er Gefallen an einer Arbeit beim IOC-Sponsor Coca-Cola fand. Er absolvierte eine Marketingausbildung und stieg bis zum Direktor der afrikanischen Niederlassung des Brause-Giganten auf. In den achtziger Jahren dominierte er den kenianischen Sportdachverband, 1989 wurde er NOK-Präsident, gelangte 1990 ins IOC, gehörte zum Council des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF und war Vizepräsident der Vereinigung der Commonwealth-Spiele. Mukora war der mächtigste Sportfürst Ostafrikas.
Zurück nun nach Monte Carlo, wo ja nicht nur die knallgelben Berliner Bewerbungsbärchen durch die Stadt liefen, wo auch handfeste Sportpolitik gemacht wurde: Coates, sein Landsmann und IOC-Kollege Phil Coles, Nyangweso und Mukora stießen auf den Mitternachtsvertrag mit ein paar Gläschen an. So früh gingen sie nicht zu Bett. Die Afrikaner hatten eben noch routiniert 70.000 Dollar für ihre Sportverbände akquiriert. Den Australiern raubte schon die Aufregung vor dem großen IOC-Zeremoniell den Schlaf, auch grübelten sie über die Frage nach, ob sich der Aufwand mit diesen Blitzverträgen wohl gelohnt haben würde. Man darf heute zumindest behaupten, daß es Sydney nicht geschadet hat.
Die Lügen des Mörders
Stunden später kamen sie zur Sache, Mukora und Nyangweso und all die anderen Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees. Im Palais Sporting d´Eté ließen sie am 23. September 1993, ab 9 Uhr in der Früh, die Olympia-Interessenten aufmarschieren. In der Reihenfolge Berlin, Sydney, Manchester, Peking und Istanbul gingen die mit prominenten Sportlern und Politikern verstärkten Werber in die Bütt. Teure Werbefilmchen waren gedreht wurden für diesen Termin, allein das Berliner Produkt kostete knapp eine Million Mark. So wurde also noch einmal gelogen, daß sich die Balken bogen: Zum Beispiel Chen Xitong, der Pekinger Bewerberchef. Er schwärmte von Frieden, Harmonie und davon, daß 1,2 Milliarden Menschen den Traum haben, die olympische Flamme in Peking brennen zu sehen. Als Bürgermeister von Peking hatte Chen Xitong vier Jahre zuvor das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens mitzuverantworten. Zwei Jahre nach Monte Carlo wurde er wegen Amtsmißbrauch und Korruption in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar zu sechzehn Jahren Haft verurteilt.
Nach den vielen ermüdenden Reden gönnten sich die IOC-Mitglieder noch eine kleine Erfríschungspause, ab 18 Uhr wurden dann die Wahlurnen an ihnen vorbeigetragen. Im ersten Wahlgang verabschiedete sich Istanbul mit 7 Stimmen. Berlin erhielt 9, Manchester 11, Sydney 30, Peking 32. Im zweiten Wahlgang wanderten Istanbuls Stimmen nach Peking ab, so daß die Chinesen nun 37 IOC-Mitglieder hinter sich hatten, Sydney blieb bei 30, Manchester erhielt 13, Berlin schied mit seinen kärglichen neun Stimmen aus, die mehr als 50 Millionen Mark aus dem Steuersäckel wert gewesen waren.
Neben Berlin verabschiedete sich jetzt auch David Sibandze aus dem Swaziland von IOC-Präsident Samaranch. Über Sibandzes Abgang wurde später viel spekuliert. „Sibandze hat von außerordentlich wichtigen Problemen gesprochen, ich habe ihn ermächtigt, zu gehen“, sagte Samaranch tags darauf. „Er hat mitten in der Session einen Anruf von seinem Minister bekommen. Er sollte sofort nach Hause fliegen, weil am nächsten Tag Wahlen im Swaziland sind“, gab indes der Ungar Pal Schmitt zum besten. Von Urnengängen im Königreich Mswatis III. berichtete seinerzeit nicht eine Nachrichtenagentur, zudem hätte Sibandze seine Heimat von Nizza aus mit keiner Flugverbindung rechtzeitig erreichen können. Auf Nachfrage erinnerte sich Sibandze später nicht mehr an den Vorgang. Der offizielle IOC-Geschichtsschreiber Wolf Lyberg entschied sich 1996 für eine unverfängliche Version: Sibandze habe einen Doktor aufgesucht.
Die Wahl ging weiter, und Manchester ereilte mit elf Stimmen das Aus. Nach der dritten Runde lag Peking mit 40 Stimmen vor Sydney (37). Die Mehrzahl derjenigen, die Manchester unterstützt hatten, wanderte nun ab nach Sydney.
45:43 triumphierten die Australier im Finale. Das Ergebnis blieb noch eine Weile geheim. Die IOC-Mitglieder wurden mit Bussen in den Salle Omnisports zur feierlichen, weltweit übertragenen Vergabezeremonie gekarrt. Die Wahlkommission überreichte Samaranch einen Briefumschlag. Der Peking-Freund nestelte an dem Papier herum, kramte ein Zettelchen hervor, erblickte den Namen – und stutzte einen Moment. Damit hatte er nicht gerechnet. Ordnungsgemäß gab er dann aber um 19.28 Uhr Ortszeit den Sieger bekannt. The winner is Sydney. Die erste Person im Saal, die jubelnd aufsprang, war Pekings massenmordender Bürgermeister Chen Xitong. Der Parteigenosse, der kein Wort Englisch verstand, glaubte, Samaranch hätte Peking gesagt.
Als Wochen später in Sydney der Rausch verflogen und das Sydney Organising Committee for the Olympic Games (Socog) gegründet war, ging man auch an die Einlösung seiner Verpflichtungen. John Coates hatte eine raffinierte Variante gewählt:
Gegenüber den elf afrikanischen NOKs und dem Duo Nyangweso/Mukora schloß er Verträge im Namen seines Nationalen Olympiakomitees AOC – offiziell hatte also weder Sydneys Bewerberkomitee noch das nachfolgende Socog damit zu tun. Die rund zwei Millionen Dollar waren auch nirgends budgetiert, wie der neue Socog-Vorstand im November 1993 konstatieren mußte. Die Sache wurde intern untersucht. Am 20. Dezember 1993 traf sich der Vorstand erneut: Zwar sei Coates nicht autorisiert gewesen, solche finanziellen Versprechungen abzugeben, wurde festgestellt. Doch habe „die Initiative in Afrika“ einen guten Zweck erfüllt. Am 23. März 1994 wurde die letzte Rate der zwei Millionen Dollar auf ein Treuhandkonto des AOC überwiesen. Von dort wurde es über Jahre in aller Stille an die Afrikaner verteilt.
„Es gab andere Faktoren“
Die olympische Ruhe wurde erst im Januar 1999 gestört. Die Affäre um Salt Lake City kochte gerade richtig auf, da meldete sich in Sydney Bruce Baird zu Wort. Er habe in der Nacht vor der Wahl in Monte Carlo einige Angebote von IOC-Mitgliedern erhalten, die ihre Stimmen verkaufen wollten, sagte Baird, der 1993 Vizepräsident des Bewerberkomitees und anschließend erster Olympiaminister des Bundesstaates New South Wales gewesen war. Ein IOC-Mitglied habe ihn persönlich angesprochen, andere afrikanische Stimmen bot ihm ein IOC-Angestellter an. Ähnliches sei bereits im Jahr zuvor im mexikanischen Acapulco, bei einem Kongreß von IOC und ACNO, offeriert worden. Baird schrieb sogar dem IOC. „Ich habe zu verstehen gegeben, daß ich über eine Anhörung vor der Untersuchungskommission sehr froh wäre. Doch leider muß ich sagen, daß das Telefon sehr still geblieben ist.“ Das Telefon blieb auch weiterhin still.
Statt dessen wurde Baird von seinem Landsmann Kevan Gosper attackiert. „Was Baird erzählt, hält keinen Vergleich zu den Vorgängen um Salt Lake City stand. Es ist wirklich nur eine Meinungsäußerung“, bellte der IOC-Exekutivler in einem Radiointerview. Baird habe keinen Beweis für einen Betrugsversuch. Ein paar Tage später erklärte Richard Pound in Lausanne, Bairds Brief habe ihn „etwas enttäuscht“. Er habe dem Schreiben „keine spezifischen Anschuldigungen“ entnehmen können.
Zu diesem Zeitpunkt, als sich die IOC-Exekutive mit der Pound-Kommission zum Krisenfall Salt Lake City traf, äußerte sich Australiens NOK-Chef John Coates recht freimütig über die Nacht der Nächte in Monte Carlo. Er plauderte über das nette Abendessen mit Nyangweso und Mukora, auch darüber, daß er ihnen so kurz vor der Wahl das Geld schriftlich versprochen hatte. „Ich weiß nicht, ob das Angebot für den Sieg entscheidend war. Aber ich dachte, es sei zu dem Zeitpunkt sehr wichtig, und ich stehe auch jetzt noch dazu“, sagte Coates. „Wir haben nicht wegen der Schönheit unserer Stadt und unserer Sportstätten gewonnen. Es gab andere Faktoren.“
Nun war wieder der schon in Lausanne weilende Gosper am Zug. In einem ersten Interview bezeichnete er das Angebot als „jenseits des Erlaubten. Das ist eine ernste Angelegenheit, das kann uns die Spiele kosten.“ Nachdem ihn die Weggefährten im IOC und in Australien auf die Tragweite seiner Äußerungen aufmerksam gemacht hatten, schwenkte Gosper um. Wenige Stunden später war alles okay: „Ich bin sehr zufrieden, daß John bis zur letzten Minute für Sydney gekämpft hat. Und ich bin froh darüber, daß man kontrollieren kann, daß unser Geld Sportlern zugute kommt.“ Von Bestechung, soviel sei klar, könne keine Rede sein. Alles habe sich im Rahmen der olympischen Solidarität bewegt.
„Gruppe von Dieben“
Die ehemaligen Kontrahenten Sydneys waren davon gar nicht so überzeugt. Sogar unter den Freunden aus Manchester regte sich vorsichtige Kritik, und die Chinesen machten natürlich sofort mobil: Sydney habe die Wahl nur durch Bestechung gewonnen, Peking sei von den IOC-Mitgliedern, dieser „kleinen Gruppe von Dieben“, betrogen worden, schimpfte die staatliche Jugendzeitung. Es gebe „keine saubere Erde unter der olympischen Flagge“, solange nicht das IOC „die Ratten“ aus seinen Reihen entferne. IOC-Vorstand He Zhenliang erklärte, Sydney müßten die Spiele wieder entzogen werden, dies sei aber nur seine „persönliche Meinung“. Er wolle die IOC-Beschlüsse abwarten und respektieren, weil das „unschuldige australische Volk“ nicht bestraft werden dürfte.
In Australien brach Panik aus. „Sydney kann die Spiele verlieren“, titelte der Herald Sun. „Sydney-Spiele in Gefahr“, hieß es auf der Titelseite von The Age. Michael Knight, der amtierende Olympiaminister, ließ rasch verbreiten, niemand denke daran, die Spiele zurückzugeben. Es sei „absolut verrückt“, zu behaupten, Sydney habe sich die Ausrichtung durch betrügerische Maßnahmen gesichert.
Und wie reagierte der IOC-Präsident? „Ich war sehr erstaunt über die Meldungen“, sagte Samaranch, „aber ich hatte großes Glück: Mein australischer Kollege Kevan Gosper war bei mir und hat mir den Vorgang erklärt.“ Samaranch fragte nicht nach.
Cousins und Cousinen
Die beste und wortgewaltigste Zusammenfassung der Affäre gab ausgerechnet der Sprecher der IOC-Sponsoren. David D’Alessandro. Er schrieb am 14. Februar 1999 in der New York Times:
Am 22. Januar gab John Coates, Präsident des Olympischen Komitees Australiens zu, zwei IOC-Mitgliedern aus Kenia und Uganda jeweils 35.000 Dollar für ihre nationalen Sportverbände zugesagt zu haben – ein paar Stunden, bevor die entscheidende Wahl des Austragungsortes für die Olympischen Sommerspiele 2000 getroffen wurde. Obwohl es später auch Hinweise auf ähnliche Bemühungen anderer Bewerber gab, ist der Fall Sydney besonders eindeutig. Es gab einen klaren Versuch, das Ergebnis des Auswahlverfahrens zu beeinflussen: Coates erklärte, er habe sich dazu entschlossen, um „mich nicht den Rest meines Lebens fragen zu müssen, warum wir nicht gewonnen haben“.
Coates enthüllte auch, daß die Zahlungen von der tatsächlichen Wahl Sydneys als Austragungsort abhängig gemacht wurden. Sydney gewann die Wahl mit zwei Stimmen Vorsprung. Am 2. Februar erklärte das IOC die Zahlungen, die in letzter Sekunde getätigt worden waren, als absolut korrekt und sprach Sydney von jeglichen Vergehen frei. Einen Tag vorher hatte das australische Olympische Komitee zugegeben, eine Zahlung in Höhe von 10.000 Dollar an die persönliche Stiftung des kenianischen IOC-Mitglieds nicht schlüssig erklären zu können.
Es stellt sich also die Frage, was das IOC unter korrekt versteht.
In Lausanne scheint das IOC auch keine eindeutige Vorstellung von dem Wort Bestechung zu haben.
Laut Wörterbuch bedeutet Bestechung „die Beeinflussung einer anderen Person durch unerlaubte Geschenke“. Das Verhalten des Bewerbungskomitees in Sydney scheint dieser Definition sehr gut zu entsprechen.
Die Medien liegen wahrscheinlich richtig, wenn sie das IOC mit einer Monarchie vergleichen. Das IOC ist wie eine königliche Familie, in der Cousins und Cousinen solange einander geheiratet haben. Bis es keinen mehr wundert, daß ihre Vorstellungen über bestimmte Dinge ein bißchen wirr sind.
Doch jetzt zum wirklich interessanten Teil: Das IOC kam zu dem Schluß, daß in Sydney nichts Unrechtes geschehen ist, und zwar schon Wochen bevor eine von Samaranch angekündigte Untersuchung stattfand, ohne daß auch nur der Versuch einer formellen Ermittlung unternommen wurde, ohne daß die Bewerbungsunterlagen Sydneys veröffentlicht und ohne daß Gespräche mit offiziellen Sportvertretern in Kenia und Uganda geführt wurden.
Trotz erdrückender Beweise räumte das IOC die Angelegenheit vom Tisch, indem die besagten Zahlungen nur als Beweis für Sydneys Glaubwürdigkeit bezeichnet wurden. Veröffentlichten Berichten zufolge gaben die Australier auch 160.000 Dollar für den Transport von sieben Pferden in die Mongolei aus, um sich die Gunst eines weiteren IOC-Mitglieds zu sichern. Wahrscheinlich hatten sich die Pferde dagegen gesträubt, Touristenklasse zu fliegen. Mit seiner Weigerung, den Fall Sydney zu untersuchen, versteckt sich das IOC hinter einem Feigenblatt – und kann so natürlich niemanden täuschen.
Was das IOC versäumte, unternahm das in Bedrängnis geratene Organisationskomitee Socog, dem bereits die ersten Sponsoren absprangen. Socog-Präsident und Olympiaminister Michael Knight setzte einen unabhängigen Rechnungsprüfer ein. Mitte März legte Tom Sheridan seinen Bericht vor und belegte eine Reihe von Verstößen gegen die Bewerbungsregeln. Da tauchten sie dann wieder auf, die Herren Sibandze (der Schnorrer ließ kaum einen Olympiabewerber aus und war zu dem Zeitpunkt bereits zurückgetreten), Mzali, Tallberg, Magwan (der von D’Alessandro erwähnte Pferdeliebhaber), Nyangweso und Mukora. Die IOC-Vorschriften bezeichnete Sheridan in seinem 75 Seiten starken Schriftstück als „unklar, nicht ausreichend und mehrdeutig“. Das IOC hat sich „nie darum gekümmert, die Einhaltung zu überwachen“. Das Schlußwort hatte Minister Knight: „Ziemlich sauber“ sei Sydneys Bewerbung gewesen, kein Vergleich zu Salt Lake City.
Wie Sydneys Bewerber kam auch Nyangweso ungeschoren davon. Das Geld aus Sydney sei für Trainingslager von Boxern und Leichtathleten verwendet worden, erklärte Nyangweso: „Diese Sache wird nur zu einem Skandal aufgeblasen. Ich habe kein Geld kassiert, die einzige Bestechung, die ich angenommen habe, war ein Abendessen mit den Olympiabewerbern.“ Der Generalmajor, Idi Amins treuer Gefährte, stieg im September 1999 als Nachfolger des aus dem IOC geworfenen Jean-Claude Ganga sogar zum afrikanischen Sportchef auf.
Für Charles Mukora indes war die traumhafte Zeit vorbei. Es gab ja nicht nur diese dumme Sache mit Sydney, die hätte er leicht überstanden. Aber es lag in Salt Lake City etwas gegen ihn vor. Von November 1993 bis Mai 1995, einen Monat vor der IOC-Abstimmung in Budapest, hatte Mukora insgesamt 34.650 Dollar erhalten. Das Geld sei für seine Stiftung zur Unterstützung des kenianischen Sports gedacht gewesen, erklärte er vor der Adhoc-Kommission des IOC.
Dummerweise hatte Tom Welch, der Bewerberchef vom Salzsee, aber schon gesagt, daß Mukora das Geld für persönliche Belange kassiert habe. Dummerweise gehörten Mukoras Tochter Salomé und sein Sohn Patrick zu den Verwaltern seiner Stiftung. So plädierten die IOC-Prüfer auf Ausschluß. Mukora kam der IOC-Session zuvor und trat am 27. Januar 1999 zurück. Fünf Tage später war er auch sein Amt als NOK-Präsident los, weil ihm zudem vorgeworfen wurde, er habe sich an einem Ausrüstervertrag mit dem Sportartikelkonzern Nike bereichert. Ein paar Monate vorher war sein Name auf der Schuldnerliste der National Bank of Nairobi aufgetaucht, die in mehreren kenianischen Zeitungen veröffentlicht wurde. Mit umgrechnet 1,1 Millionen Mark stand Mukora bei dem Geldinstitut in der Kreide, das nur mit einer Finanzspritze der Regierung überleben konnte.
Er sei ein „unglückliches Opfer“ der Umstände, er müsse sich nichts vorwerfen und trete „aus prinzipiellen Gründen“ zurück, sagte Mukora zu seinem Abschied aus dem IOC. „Ich bin nur zurückgetreten, damit keiner denkt, ich sei bestochen worden.“
Übrigens gibt es in Kenia ein geflügeltes Wort, demnach ist dumm, wer einen hohen Posten nicht zur persönlichen Bereicherung ausnutzt. Dumm war Charles Nderitu Mukora also nicht. Eher ziemlich raffiniert. Der Name Mukora bedeutet, aus der Stammessprache Kikuyu übersetzt, nichts anderes als – Dieb.


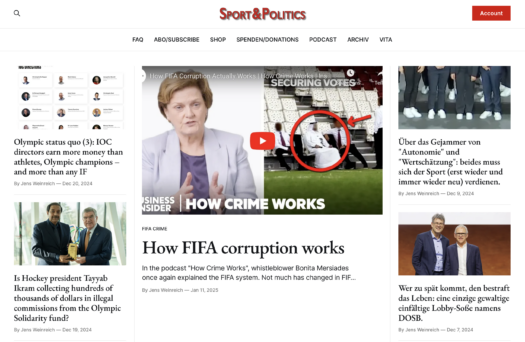





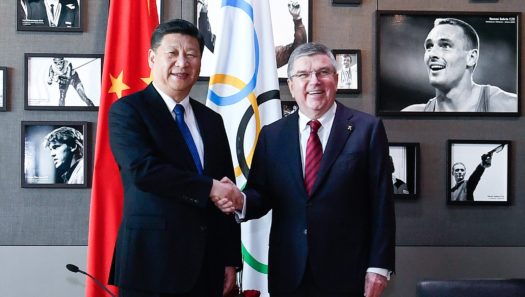



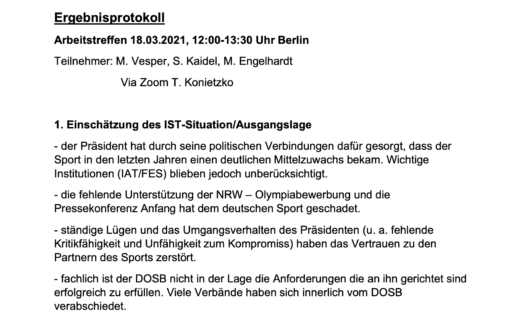


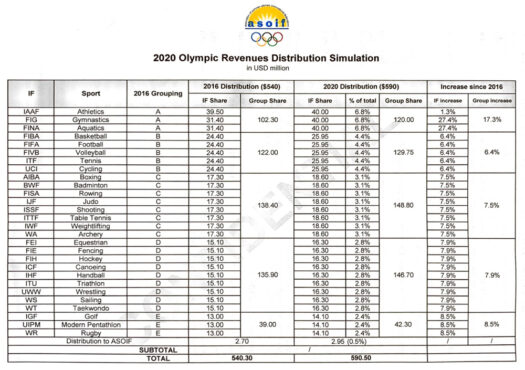


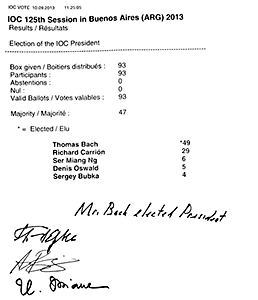

Video funzt nicht.
bei mir funzt – ohne dsl-anschluss ein paar kilometer von der berliner stadtgrenze, danke telekom! – eigentlich nicht viel. dieses video aber funzt, in firefox und explorer. du bist der internet-experte?!
Pingback: Links - Mar 30 « roxomatic links
„Er schwärmte von Frieden, Harmonie und davon, daß 1,2 Millionen Menschen den Traum haben, die olympische Flamme in Peking brennen zu sehen.“
Falls hiermit die Einwohner Chinas gemeint sind, würde ich 1,2 Milliarden draus machen
Oh ja. Danke. Schon geschehen. Obwohl: vielleicht hat er nur 1,2 Millionen Parteifunktionäre gemeint? Ich habe übrigens neulich interessante Zahlen gehört, von einem Experten: Demnach sind von den rund 3.200 chinesischen Multimillionären 91 Prozent Kinder oder andere Verwandte von hochrangigen Funktionären der KP.
Hier dazu mehr: http://sportnetzwerk.eu/?p=47
Pingback: Was zu Berlin passt … : jens weinreich
Pingback: Wie die Leichtathletik-WM nach Berlin kam : jens weinreich
Pingback: Olympia 2018, die Ausgangslage: Pyeongchang vor Pyeongchang vor Pyeongchang : jens weinreich
Pingback: Wie die Leichtathletik-WM nach Berlin kam • Sport and Politics
Pingback: Der Überlebenskampf: Olympische Winterspiele 2026 • Sport and Politics
Pingback: Gegen die Wand: Deutschland und seine Olympiabewerbungen #NRW2032 • Sport and Politics
Pingback: WADA suspendiert das Land, das vier Jahre nicht Russland genannt werden soll • SPORT & POLITICS
Pingback: Gegen die Wand (2): Brisbane und #NRW2032 - SPORT & POLITICS
Pingback: Wenn die Kraft nicht mehr zum Weinen reicht: Schildkrötenblut und Caipirinha in Eimern – SPORT & POLITICS